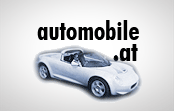Manch einer kennt den Namen "Elf" von klassischen Tankstellen, bevorzugt in Frankreich. Doch bei Mercedes hat man mit diesem Namen gewissermaßen das genaue Gegenteil im Sinn. Dort richtet man mit dem Experimental-Lade-Fahrzeug ELF den Fokus nicht nur auf lokal CO₂-emissionsfreies Fahren, sondern zugleich auf intelligentes Laden und Ressourcenschonung.
Das Unternehmen betont, dass effiziente, vernetzte Ladelösungen neben dem Fahrzeug selbst eine entscheidende Rolle spielen; Beispiele aus der Praxis sind die Einführung von MB.CHARGE Public 2019 als vernetzter Ladedienst und die Plug-&-Charge-Funktion, die Mercedes 2021 als einer der ersten Hersteller auf den Markt brachte.

In MB.CHARGE ist zudem das Konzept "Green Charging" integriert, das in Europa, Kanada und den USA den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien durch Grünstromzertifikate fördert (Zertifikate stammen aus Anlagen jünger als sechs Jahre; Ausnahmen: Großbritannien und Polen).
Das ELF dient als rollendes Ladelabor und kombiniert in einem Fahrzeug mehrere Ladeformen: ultraschnelles DC-Laden, bidirektionales Laden, solare Ladekonzepte sowie induktives und konduktives Laden. Ziel ist es, technische Grenzen auszuloten und gleichzeitig seriennahe Komponenten unter realen Bedingungen zu erproben.
Für das Schnellladen verfolgt Mercedes einen doppelten Ansatz: Mit dem MCS-Stecker (Megawatt Charging System), ursprünglich für Schwerlastverkehr entwickelt, wird im ELF die thermische Belastbarkeit und die Leistungsgrenze von Hochvoltbatterien, Leistungselektronik und Ladekabeln unter Extrembedingungen untersucht.

Parallel testet das Fahrzeug das Combined Charging System (CCS) als Pkw-Standard; im ELF sind mit CCS Ladeleistungen von bis zu 900 kW möglich, wodurch sich 100 kWh in etwa zehn Minuten nachladen lassen. Die im ELF eingesetzten CCS-Komponenten sind seriennahe Entwicklungen, deren Erkenntnisse in künftige Fahrzeuggenerationen einfließen sollen.
Ergänzend zu diesen Arbeiten steht das Technologieprogramm CONCEPT AMG GT XX, das Hochleistungsladen demonstriert: Das Konzept kann innerhalb von fünf Minuten Energie für rund 400 Kilometer Reichweite (WLTP-Standard) nachladen und erreichte bei einer Rekordfahrt Durchschnittsladeleistungen von etwa 850 kW bei 1.000 Ampere; beim Megawattladen wurde sogar eine Spitze von 1.041 kW gemessen.
Für solche Leistungen entwickelte Mercedes gemeinsam mit dem Ladeinfrastruktur-Partner Alpitronic einen Prototypen einer Hochleistungs-Ladesäule. Durch die Adaption einer MCS-Säule und den Einsatz eines gekühlten CCS-Kabels lässt sich erstmals ein Strom von bis zu 1.000 Ampere über ein CCS-Kabel übertragen; die Kühlung von Stecker und Kabel bleibt dabei erhalten. Prototypenprüfstände in Stuttgart-Untertürkheim dienten zur gemeinsamen Validierung von Fahrzeugkomponenten und Ladesäule.

Bidirektionales Laden betrachtet Mercedes als strategischen Baustein für die Energieintegration von Elektrofahrzeugen. Das ELF testet AC- und DC-bidirektionales Laden: AC-Bidirektionalität ermöglicht V2L (Vehicle-to-Load) sowie die Rückspeisung ins Hausnetz (V2H) oder Gebäude (V2B) über eine bidirektionale AC-Wallbox; der Vorteil sind geringere Infrastrukturkosten, der Nachteil jedoch komplexere Standardisierungsanforderungen.
DC-Bidirektionalität erlaubt die direkte Rückspeisung ins öffentliche Netz (V2G) oder ins Hausnetz (V2H/V2B) über eine bidirektionale DC-Wallbox; hier bietet sich höhere Effizienz, besonders bei Einsatz eines Hybrid-Wechselrichters, allerdings zu höheren Investitionskosten. Mercedes nennt als praxisnahe Perspektive, dass Fahrzeuge mit Hochvoltbatterien von 70 bis 100 kWh einen Einfamilienhaushalt zwei bis vier Tage mit Strom versorgen können. Das Unternehmen bereitet konkrete Kundendienstleistungen vor:
Der vollelektrische CLA und der neue GLC sind technisch für bidirektionales DC-Laden vorbereitet, und erste Services für bidirektionales Laden sollen noch 2026 in Deutschland, Frankreich und Großbritannien starten; weitere Märkte folgen. MB.CHARGE Home kombiniert Fahrzeug, bidirektionale Wallbox, Ökostromtarif und Marktzugang und ermöglicht über intelligentes Energiemanagement sowie eine Steuerungs-App kostenoptimiertes Laden und Rückspeisung; Mercedes nennt mögliche Einsparungen von rund 500 Euro pro Jahr (je nach Nutzungsszenario), was etwa 10.000 kostenlosen Kilometern entspricht.

Ein weiterer Baustein im ELF-Programm ist die Erprobung induktiven Ladens per magnetischer Resonanz; aktuell liegt die Leistung bei etwa 11 kW AC. Die Technologie wird auf Wirkungsgrad, Alltagstauglichkeit und Kompatibilität mit unterschiedlichen Fahrzeughöhen und -positionen geprüft.
Parallel dazu testet Mercedes (wie bereits Porsche beim neuen Cayenne) konduktives Unterbodenladen mit einer 11-kW-AC-Leistung über einen im Fahrzeugboden integrierten Connector; diese Lösung erfordert präzise Parkpositionierung, bietet jedoch eine effizientere Energieübertragung als induktives Laden und verringert Kabelverschleiß.
Für Anwendungsfälle mit hohen Ladeleistungen untersucht Mercedes automatisierte, robotergestützte Ladesysteme, die präzises, sicheres und automatisches Verbinden großer Kabelquerschnitte ermöglichen - relevant für Flotten, Barrierefreiheit und das Premiumsegment.

Technologisch übergreifend denkt Mercedes das Laden als Ökosystem: Mit der internen Charging Unit treibt das Unternehmen den Rollout des Mercedes-Benz Charging Network voran und entwickelt die digitale Infrastruktur MB.CHARGE als Rückgrat für Verknüpfung von Fahrzeug, Ladeinfrastruktur und Cloud-Plattform.
Eine angedachte Option ist ein "virtuelles Energiekonto", das erzeugten Solarstrom und netzdienliche Ladevorgänge in Gutschriften umsetzt, die Kunden später flexibel an öffentlichen oder privaten Ladepunkten nutzen können. Voraussetzung hierfür sind tiefe Integration, geschlossene Ökosysteme und geeignete regulatorische Rahmenbedingungen, etwa Ausnahmeregelungen bei Netzentgelten analog zu Großspeichern in der Markteinführungsphase.
In der Summe bündelt das ELF-Programm Forschung zu ultraschnellem Laden, bidirektionaler Energieintegration, kabellosen und automatisierten Ladesystemen sowie zur praktischen Umsetzung eines vernetzten Ladeökosystems. Mercedes nutzt die gewonnenen Erkenntnisse sowohl zur Weiterentwicklung künftiger Serienmodelle als auch zur Vorbereitung neuer Ladeinfrastrukturgenerationen, mit dem Ziel, Ladezeiten zu verringern, Flexibilität zu erhöhen und die Rolle von Elektrofahrzeugen im Energiesystem auszubauen.